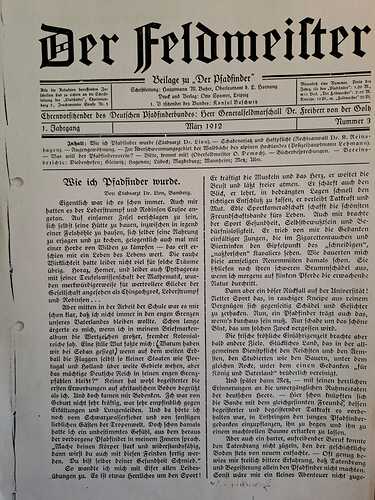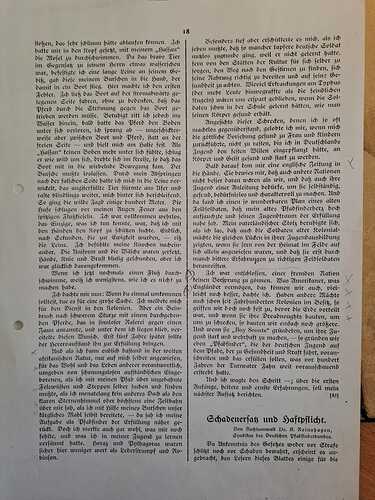Hey liebe Mitlesende,
Fuchs aus der AG Kolonialismuskritik hier. Ich hoffe, ein bisschen Substanz für die Diskussion liefern zu können, damit hier nicht einfach Fragen im Raum stehen ohne beantwortet zu werden und sich am Ende alle denken „jo stimmt, die Diskussion ist irrelevant“.
Da ich selbst höchstens noch als Vertretung aktive Gruppenarbeit mache, möchte ich mich zur Frage von Entscheidungen zurückhalten. Aber im Antrag lese ich vor allem auch erstmal ein Bedürfnis nach Auseinandersetzung und Verstehen, das wurde hier ja mehrfach erklärt.
Seit mehr als 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Kolonialismus und Pfadfinden und habe dazu schon mit vielen Aktiven Gedanken ausgetauscht und von diversen Pfadi-Geschichts-Nerds gelernt. Unter anderem diese Arbeit hat solche Diskussionen wie diese hier weiter befeuert (was mich freut – Wo Bewegung, da Veränderung und da sehe ich eine hellere Zukunft). Jetzt geht es aber natürlich darum, dass wir einerseits verstehen, wovon wir reden, und andererseits konstruktiv schauen, welche Schlüsse wir ziehen wollen. Vor dem Hintergrund der Fachtagung Pfadfinden zum Thema „Kolonialismus und Pfadfinden“, die letztes Wochenende stattgefunden hat, möchte ich ein paar Punkte und Anregungen teilen.
Vorab: Ja, ich hab Kram studiert, der sich mit sowas auseinandersetzt und auch beruflich berühren mich Themen wie Kolonialismus und strukturelle Diskriminierung. Und ja, nicht alles, was ich dazu sagen kann ist sofort direkt anwendbar für die praktische Arbeit in den Gruppen und es ist auch nicht mein Anspruch, dass alle aktiven BdPler* innen Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber: Es ist meine Erfahrung (nach vielen Workshops und Kurseinheiten und Anfragen), dass diese Themen vielen Pfadfinder* innen ein Anliegen sind – Weil ihnen was aufgefallen ist und sie sich damit mindestens unwohl fühlen. Und viele Gruppenleitungen und Teamer* innen im BdP experimentieren (eigentlich schon immer) damit, wie z.B. Erkenntnisse aus Geschichtswissenschaften, Sozialwissenschaften, etc. etc. praktisch unsere Arbeit informieren und letztendlich „besser“ machen können. In unseren Methoden finden wir eine Kombi von Erfahrung, Intuition und auch Hirnschmalz. Ich finde, das ist ein Schatz.
Ich schätze konstruktive Kritik, aber den Schuh mit dem abfälligen Verweis auf die Uni-Seminare ziehe ich mir nicht an. Aber: Ich sehe das als Aufruf, dass unser Lernen praktisch relevant bleiben muss. Ich setze mich ja auch nicht in eine Runde von Tischler* innen und erzähle denen wir nervig ich die Details über welcher Leim wofür finde – Ich bin ja froh, wenn die stabile Möbel bauen. Das machen die auch deshalb so gut, weil denen regelmäßig jemand Rückmeldung gibt, ob er* sie bequem sitzt. (Funktioniert die Metapher für euch?)
Deshalb folgt hier ein recht langer Beitrag mit hoffentlich einigen recht konkreten Fragen und Anregungen.
Ich gehe sehr da mit, dass unsere Stufenarbeit und damit die Begriffe von uns selbst mit Leben gefüllt werden sollen und darin sind wir ziemlich gut. Ich denke auch, dass Bedeutungen sich wandeln können. Aber kritisch zu hinterfragen, ob aus der Geschichte nicht vielleicht doch was weitergetragen wird, was unseren Idealen widerspricht, kann erhellend und produktiv sein. Ob das dann letztendlich bedeutet, dass wir Begriffe ablegen müssen, ist damit nicht gesagt.
Also hier meine 50 Cent zu den Begriffshintergründen (nachdem ich nochmal mit einigen Leuten aus meinem Umfeld gequatscht habe):
Das Dschungelbuch selbst stammt aus einem klar kolonialistischen Kontext - der Artikel, den Wiebke und ich vor 4 Jahren geschrieben haben wird ja hier zitiert, mittlerweile haben wir mit immer mehr Menschen darüber gesprochen und konnten noch mehr lernen.
Es gibt unterschiedliche Analysen dessen, ob dieser Kontext und dieses Weltbild auch heute noch von Kindern, die es lesen verstanden wird (weil z.B. die Metaphern von heutigen Leser*innen nicht direkt mit dem britischen Imperialismus in Zusammenhang gebracht werden). Was ich aber schon häufig von aktiven Meutenführungen gehört habe ist, dass ihnen direkt auffällt, wie im Dschungelbuch Ideen einer recht gewaltvollen Erziehung transportiert werden. Vor allem deshalb gibt es modernere Überarbeitungen, die einige Meutenführungen nutzen.
Was man festhalten kann: Ob das Dschungelbuch genutzt wird oder nicht, ist von Stamm zu Stamm sehr unterschiedlich und unterschiedlich ist auch, welche Fassung genutzt wird. Immer mal wieder wird noch heute hier und da die Urfassung hervorgekramt auf der Suche nach Futter für Spielgeschichten und Programm - Es ist nun mal (Stand Jetzt) die Grundlage der Wölflingspädagogik. Ist halt die Frage, wie wir damit umgehen wollen und ob das nicht vielleicht doch irgendwo dazu beiträgt dass koloniale Weltbilder mehr normalisiert als hinterfragt werden. Ich denke, mit aktiven Meutenführungen und auch Wölflingen sprechen hilft: Was wollen die vom Dschungelbuch? Und finden die darin, was sie wollen? Oder sind die eigenen, in der Gruppe erfundenen, Traditionen, die vielleicht nicht unbedingt was mit dem Buch zu tun haben, viel wichtiger und geliebter?
Hier lohnt ein Austausch z.B. mit dem VCP. Die haben gerade beschlossen die Spielgeschichte für die Wölflingsstufe bis 2028 zu überarbeiten.
Was die Diskussion auch informieren könnte ist mal mit Leuten zu sprechen, die keine Pfadfinder*innen sind. Denn das wir alle mit unseren Begriffen was Positives verbinden ist klar (wir machen ja auch tolle Arbeit), aber wir wollen ja auch ggf. mehr Kinder erreichen.
Dazu ein Eindruck der Fachtagung Pfadfinden: Chrissi Hunger (VCP) und Raani Keldermann (Vorsitzende der Scouts Aotearoa) haben dort einen Workshop organisiert unter dem Titel „Why to say Goodbye to the Jungle Book and how?“
Ein interessanter Punkt von Raani: Sie haben explizit bei z.B. Gemeinden der Maori und Südasiatischen Bevölkerung nachgefragt, ob Pfadfinden für sie interessant ist und sie ihre Kinder anmelden würden. Ein Punkt (unter vielen), der zurückgemeldet wurde, war, dass diese Gruppen das Dschungelbuch explizit als rassistisch ansehen und mindestens ein ungutes Gefühl hätten ihre Kinder bei einem Verband anzumelden, der es als Spielgeschichte nutzt. Die Scouts Aoteaora haben das nicht nochmal groß nachgeforscht (keine musste ein Uni-Seminar dafür belegen ;-)), sondern einfach angenommen und gesagt: Ja okay, dann besser was anderes. Interessant hier: Sie nutzen weiterhin den Begriff „Cubs“, aber eben nicht mehr das Dschungelbuch.
Und auch spannend: In unserem Workshop auf der Fachtagung haben diese Fragen vor allem ein Gespräch darüber geöffnet, was wir eigentlich mit Geschichten erreichen wollen, und was Kinder unserer Erfahrung nach cool und aufregend finden. Das sind meiner Erfahrung nach die wirklich spannenden Fragen (und auch die können dazu führen bestimmte Traditionen abzulegen – weil Kinder sich eventuell nicht darin wiederfinden. Wie gesagt: KANN sein).
Ich hab kürzlich mit einer indischen Freundin von mir über das Dschungelbuch gesprochen und sie sagte direkt „Ah you mean the book that’s telling us we are uncivilized? Of course I know that!“ (Das ist erstmal eine Annekdote, eine Einzelperson, aber: Es kann sehr gut sein, dass das Dschungelbuch unter südasiatischen Menschen recht bekannt ist und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne, eben wegen Rudyard Kipling - Über den Imperialismus in seiner Literatur gibt es viele Analysen, am bekanntesten vom postkolonialen Theoretiker Edward Said). Long Story Short: Was uns vermutlich als Bewegung weiterbringen würde ist, mit Menschen, deren Familien Opfer kolonialer Gewalt geworden sind, darüber zu sprechen, wie die auf das Dschungelbuch schauen. Wahrscheinlich kriegen wir da sehr viele unterschiedliche, interessante, hilfreiche Perspektiven auf unsere Arbeit.
Zu den Begriffen Rover / Ranger: Soweit ich informiert bin kann Rover auch mit „fahrender Geselle“ übersetzt werden. Ranger kann auch wörtlich „Waldhüter*in“ heißen. Ich bin wie Timon der Ansicht, dass die Begriffe im Englischen auch genderneutral verwendet werden. Das Argument mit den Berufsbezeichnungen verstehe ich noch nicht ganz. Könnt ihr erklären, was euch hier aufgestoßen ist? (interessante Diskussion).
Und hier ein Link von Wikipedia, was Olave Baden-Powell über die Einführung des Begriffes Ranger sagte: „To range“ means to travel, or to rove over wide distances, whether in your mind or your body. A Ranger is „one who guards a large tract of land or forest,“ thus it come to mean one who has the wide outlook, and a sense of responsible protective duties, appropriate to a Senior Guide. Another definition is „to sail along in a parallel direction,“ and so we can feel that the Ranger Guides are complementary to the Rover Scouts. Ranger (Girl Guide) - Wikipedia (für mehr Kontext besser den ganzen Artikel lesen)
Zur Einordnung der Begriffe kann ich nicht viel sagen, wäre sicherlich interessant sich da nochmal tiefer mit auseinanderzusetzen. Aber: Wenn viele von uns die Begriffe nicht genderneutral lesen, dann ist das meiner Meinung nach Grund genug für eine Auseinandersetzung, wie es die Antragssteller*innen ja vorschlagen. Aber hier sollten wir vorsichtig sein: Es kommt immer wieder vor, dass Begriffe, die eher aus der WAGGGS als aus der WOSM-Richtung stammen als uncool abgestempelt werden oder einfach nicht verwendet werden. Was ich interessant fände, wäre zu besprechen, wie wir damit umgehen wollen, wenn einige Begriffe explizit als Selbstbezeichnung für weibliche Pfadfinderinnen eingeführt wurden (für Sichtbarkeit, Teilhabe), sich heute aber nun viele von uns genderneutrale, nicht binär-verhaftete Bezeichnungen wünschen (verständlicherweise). Ich meine einfach, wir sollten die feministischen Erfolge hier nicht vergessen in unseren Überlegungen.
Zum Begriff Pfadfinder: Ich bin mir nicht ganz sicher woher der Begriff selbst „ursprünglich“ stammt. In unsere Bewegung hat er es aber über Referenzen auf First Nation Americans geschafft (sorry für die Fachbegriffe, ich hoffe, die, die es interessiert verstehen den Punkt, ansonsten lasst uns ins Gespräch kommen). Baden-Powell spricht von Kundschaftlern der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, die Pathfinder genannt wurden (oder sich selbst so nannten? Weiß ich nicht, müsste man mal recherchieren, denn was Baden-Powell so dachte, was Leute für Begriffe und Traditionen verwendet haben, war häufig auch einfach sein eigener Blick und was er gerade für seine Erzählung brauchbar fand). Lion und Bayer hatten den Begriff wohl sehr klar aus den „Leatherstocking Tales“ (ich hänge hier mal einen Artikel von Lion an, da kann man nachlesen wie in der Blick über die Steppe Namibias inspirierte – Eine Steppe, die die Deutschen z.B. den Herero und Nama wegnahmen, was im Genozid gipfelte und bis heute kaum aufgearbeitet ist). Abenteuerromane aus dieser Zeit transportieren ein Bild von Entdeckertum, dass wir hoffentlich (!) nicht mehr in unserer Pädagogik und unseren Spielgeschichten weitertransportieren (ich denke hier ist vor allem Selbstreflektion und eine Sensibilisierung für kolonialrassistische Klischees wichtig: Was für Ideen und Träume wollen wir weitergeben? Woran denken wir, wenn wir an ein Leben in der Wildnis denken? Wie stellen wir uns den Kontakt mit uns fremden Menschen vor? Etc. etc., nur als Anregung)
Hier würde ich der Argumentation im Antragstext etwas hinzufügen, weil ich das wichtig finde: Ich würde es dennoch so einordnen, dass der Begriff Pfadfinder selbst aus einer kolonialistischen Tradition (oder Weltbild) stammt. Lion und Bayer haben wohl nach einem Begriff gesucht, der weniger militaristisch aussieht, aber was sie dann im Pfadfinderbuch geschrieben haben, liest sich deutlich mehr wie eine Militärausbildung als die weiteren Editionen von Scouting for Boys. Die Bücher sind voll von Anekdoten aus den Kolonien. Die beiden haben sich im heutigen Namibia (damals von Deutschen „Deutsch-Südwestafrika“) kennengelernt (https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1558794/1/Bowersox--Bamberg.pdf) . Lion war dort Stabsarzt, Bayer Hauptmann. Von beiden findet man heftig rassistische Schriften, vor allem von Bayer voll von seinen genozidalen geistigen Ergüssen, wen es interessiert: Stephan Schrölkamp hat eine Sammlung von Materialien in seinem Archiv in Steglitz, die er gerne zur Recherche zur Verfügung stellt.
Wichtig festzuhalten: Vor allem bei Bayer kann man ziemlich klar sagen, dass er Mitverantwortung trägt für den Genozid der Deutschen an Ovaherero und Name (z.B. Seite 108 hier https://library.fes.de/pdf-files/bueros/namibia/21437.pdf ). Lion wurde dann selbst im Rahmen des Nationalsozialismus Opfer der antisemitischen Verfolgung (man lernt viel über Deutsche Geschichte und Identitäten, wenn man sich seine Lebensgeschichte mal anschaut).
Weshalb ich das hier schreibe: Ich finde es wichtig, dass hier nicht ohne Kontext der Eindruck erweckt wird, die beiden hätten die militaristische, kolonialistische Tradition besonders tief reflektiert und sich aktiv von ihr abgewandt. Ich verstehe sie nicht als Vorbilder sondern als Täter in einem bisher unzureichend aufgearbeiteten Genozid.
Und zum Begriff und was der heute bedeutet: Ich finde ihn mindestens so cringe wie ich mich gerne damit identifiziere und direkt den Geruch von Lagerfeuer und Wald in der Nase habe wie er mich an unser koloniales Erbe denken lässt. Mich interessiert wie lange wir uns in Deutschland noch so nennen werden – Let’s see.
Ich komme mittlerweile immer wieder zu folgenden Schlüssen in solchen Diskussionen:
- Ja, wir selbst füllen unsere Gruppenarbeit und damit auch Begriffe mit Bedeutung und Leben. Das ist ein ziemlicher Schatz und wir sollten uns bewusst machen, was wir daran haben – und in Bewegung bleiben.
- Es würde uns vermutlich aber darüber hinaus auch helfen, zu schauen, wie wir von nicht-Pfadfinder*innen wahrgenommen werden (und für den Anfang: Auch von leiseren Stimmen in unseren eigenen Reihen, die ggf. schon jetzt, von innen heraus ein unwohles Gefühl mit einigen Traditionen haben), vor allem von denen, die wir bisher nicht erfolgreich ansprechen – Denn: Wir wollen ja immer wieder neue Kinder und Jugendliche erreichen und davon überzeugen, bei uns Mitglied zu werden.
- Und: Wir wollen in unseren Gruppen auf eine Art Pfadfinden leben, die unseren Mitgliedern dabei hilft, den Herausforderungen der heutigen Welt gewachsen zu sein und sich für Gerechtigkeit und eine schöne Zukunft einzusetzen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es dabei hilft, hier und da Anpassungen vorzunehmen (bei tief- und weitgreifenden Sachen, die viele auf einmal betreffen am besten eben wohlüberlegt) – Cool!
- Ich liebe ja diesen Absatz, der hier schon z.B. von Satan zitiert wurde mit „Wir leben in der Welt von heute“ – Bei einer Bewegung mit so vielen Traditionen wie unserer kann es manchmal passieren, dass wir uns etwas selbst im Weg stehen und uns (auch mal unbewusst) Wege verbauen für Veränderung, die wir vielleicht intuitiv schon längst eingeschlagen hätten.
- Ich persönlich glaube, dass das reine Ablegen von Begriffen nicht so viel bringt, wenn wir uns im Prozess nicht mit dem auseinandersetzen, was dahinter liegt. z.B. eine Sensibilisierung für Auswirkungen des Kolonialismus ganz konkret was Ausbeutung und Diskriminierung angeht. – Die Auseinandersetzung sollte Hand-in-Hand stattfinden. Das soll keine Kritik an diesem Antrag sein, sondern die dazugehörende Diskussion dahin lenken: In was für einer Welt wollen wir leben? Was sind unsere Werte?
- Abschließend: Ich freue mich ja, wenn sich Leute in Deutschland heute mit Kolonialismus und anderen Systemen von Unterdrückung und Gewalt auseinandersetzen. Einige haben über das Hinterfragen unserer Methodik und Begriffe da einen tieferen Einstieg gefunden – Willkommen im Club

![]()